Dr. Stefan Lang am 09. Juni 2017
In der Doktorarbeit Fachbegriffe einheitlich verwenden!
Kategorie Kampagne für Verständlichkeit
Die Deutschlehrer sind schuld, ja die Deutschlehrer. Denn sie haben uns eingebläut: „Eine Wortwiederholung ist böse!“ Dafür gab es dann das rote „W“ am Rand. Doch das Gegenteil ist schlimmer: Synonymitis!
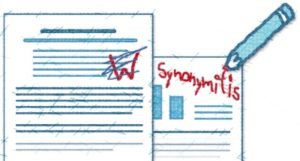
Synonymitis bedeutet, dass man grundsätzlich einen Begriff nur einmal in seinem Text verwendet und dann nach einer Alternative gleicher Bedeutung sucht, also nach einem Synonym. Aber was spricht eigentlich gegen eine Wortwiederholung? Im Deutschunterricht wurde die Wortwiderholung gebrandmarkt bzw. die Synonymitis favorisiert, wahrscheinlich um die Schüler zu ermuntern, ihren Wortschatz zu erweitern.
Beim wissenschaftlichen Schreiben einer medizinischen Doktorarbeit gelten jedoch andere Regeln. Hier ist es aus Gründen der Verständlichkeit wichtig, Fachbegriffe einheitlich zu verwenden, also zu wiederholen.
Warum wir in der Doktorarbeit Fachbegriffe wiederholen müssen
Angenommen, wir lesen in einer medizinischen Doktorarbeit von folgenden Behandlungsoptionen. Können Sie sich sicher sein, ob es sich um ein einziges oder vier verschiedene Optionen handelte?
- anti-inflammatorischer Wirkstoff
- Entzündungshemmer
- anti-entzündliches Medikament
- Substanz mit anti-inflammatorischen Eigenschaften
Neues Wort = neue Sache
Was passiert beim Lesen? Beim ersten Synonym Entzündungshemmer ist es nur ein leichtes Stirnrunzeln, weil man sich nicht 100%ig sicher ist, ob damit der anti-inflammatorische Wirkstoff gemein ist. Bei anti-entzündliches Medikament fängt man schon an, sich irritiert am Kopf zu kratzen. Und bei Substanz mit anti-inflammatorischen Eigenschaften ist man überzeugt, den Text nicht richtig zu verstehen.
Das Problem: Leser und Leserin erwarten bei einem neuen Begriff intuitiv eine neue Sache. Manchmal kann er oder sie sich aus dem Kontext erschließen, dass wohl das Gleiche gemeint ist, aber das kostet Energie. Und manchmal geht es schief.
Keine Variationen im wissenschaftlichen Schreiben – haben Sie einmal einen treffenden Schlüsselbegriff gefunden, dann bleiben Sie dabei.

