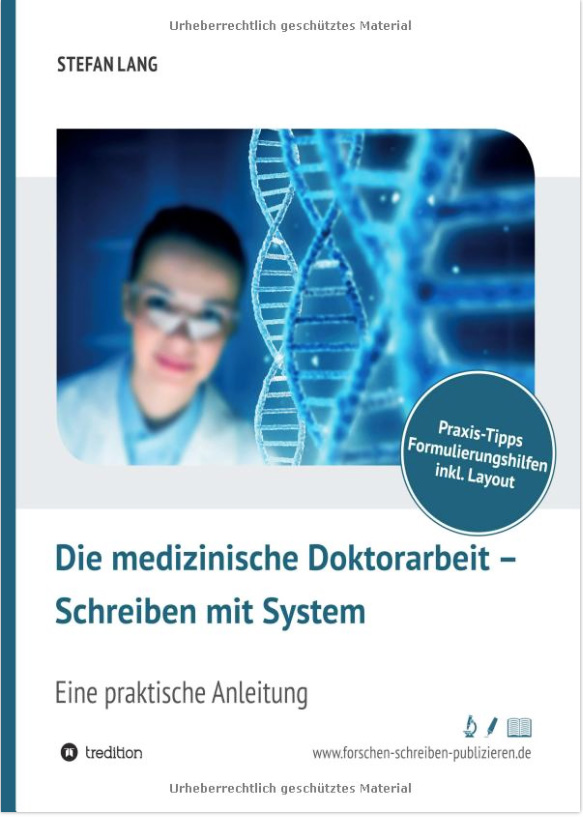Dr. Stefan Lang am 11. Oktober 2019
Doktorarbeit schreiben: Wie gut sind die Tipps vom Prof?
Kategorie Schreib- und Publikationsprozess
Wenn es an das Schreiben der Doktorarbeit geht, sollte man natürlich seine wissenschaftlichen Ergebnisse mit Doktorvater oder Doktormutter besprechen. In solchen Gesprächen kommt das Thema dann irgendwann auch aufs Schreiben. Aber nicht immer ist ein medizinischer Fachmann auch ein Fachmann fürs wissenschaftliche Schreiben. Hier eine Liste mit Tipps, die zwar gutgemeint, aber wenig hilfreich sind.
Oft geben Doktorvater und Doktormutter nur das weiter, was sie sich selbst, autodidaktisch, irgendwann einmal angeeignet und angewöhnt haben – und das ist nicht immer die effektivste Arbeitsweise.
Hier eine Liste von Ratschlägen, die man unbedingt hinterfragen sollte.
„Literaturverwaltungssoftware? Brauchen Sie nicht“
Tatsächlich, es gibt noch Professorinnen und Professoren, die ihre Manuskripte ohne eine Literaturverwaltungssoftware schreiben. Entweder, weil sie noch nie mit einem solchen Programm gearbeitet haben und das immer schon per Hand erledigt haben, oder weil sie die Software für zu fehleranfällig halten.
Arme Doktoranden und Doktorandinnen, die diesen Ratschlag befolgen Denn das Gegenteil ist der Fall. Versucht man aber ein Literaturverzeichnis manuell etwa mithilfe einer Exceltabelle zu erstellen und die Zitate per Hand in den Text einzufügen, geht das 100%-ig schief. Fehler sind dann vorprogrammiert.
Technische Hilfsmittel sollte man einsetzen, auch wenn der Prof oder die Professorin sie nicht mag.
„Das macht man so.“
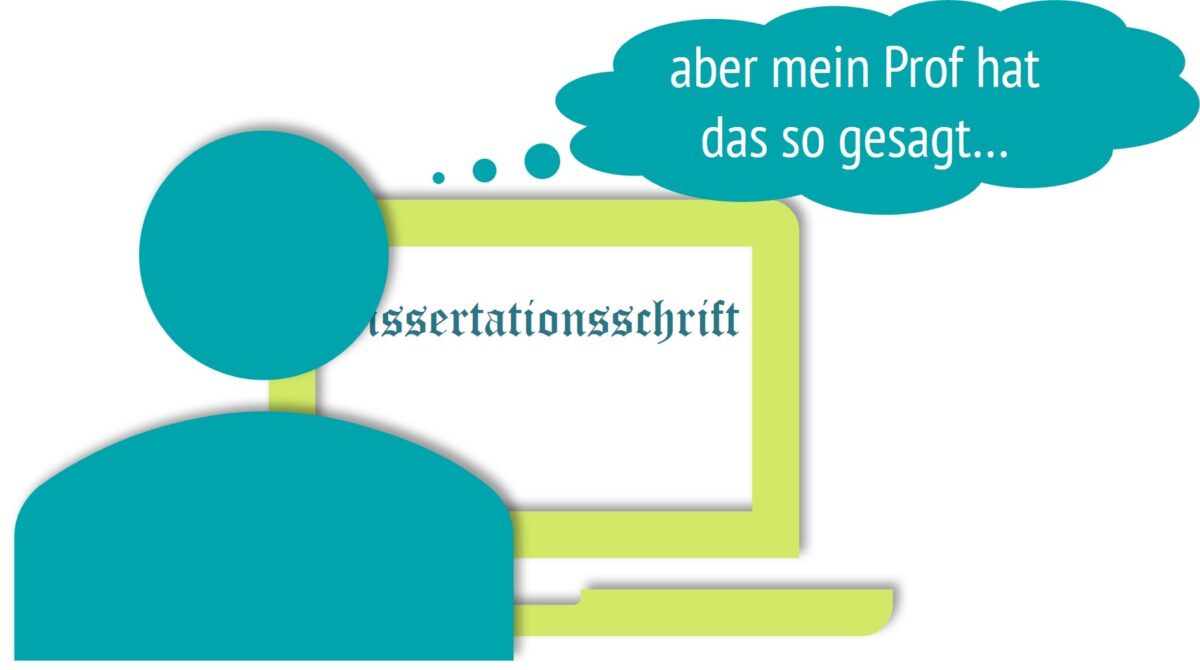
Vorsicht mit Pauschal-Aussagen aller Art. Sie sind in den meisten Fällen Quatsch. Solche „Das macht man so“-Aussagen betreffen oft den Umfang einzelner Abschnitte („Eine Einleitung darf maximal fünf Seiten lang sein.“). Unsinn, denn schließlich hängt es ja immer vom Thema ab, wieviel Text man braucht, um etwas vernünftig zu erklären.
Stellen Sie alle pauschalen Anweisungen auf den Prüfstand.
„Eine Interpretation gehört ausschließlich in die Diskussion.“
Falsch, das ist ein Mythos, der sich hartnäckig hält bzw. meist falsch verstanden wird. Natürlich muss man im Ergebnisteil seine Daten und Messergebnisse interpretieren und seinen Lesern erklären, was die Zahlen bedeuten. Denn wie will man sonst zum nächsten Versuch überleiten und eine Fragestellung schrittweise beantworten?
Ausschließlich in die Diskussion gehören weiterführende Interpretationen, bei denen man seine Datengrundlage verlässt bzw. in einen größeren Kontext einordnet und mit Literatur abgleicht.
Auch hier: Pauschal-Anweisungen nicht ungeprüft befolgen.
„Wir benutzen hier die alte Rechtschreibung.“
Echt, jetzt? Wenn Doktormutter oder Doktorvater so etwas verlangt (hat mir neulich eine Workshop-Teilnehmerin erzählt), sollte man auf die aktuelle Promotionsordnung verweisen – und hart bleiben. Denn man schreibt nicht nur für Doktorvater und Doktormutter, sondern für Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus dem ganzen Land – und auch für potenzielle Arbeitgeber, bei denen man sich nach Abschluss der Promotion bewerben möchte.
Immer die aktuellen Gepflogenheiten des Scientific Writing und gängigen Rechtschreibregeln berücksichtigen.
„Der Text muss nach Wissenschaft klingen.“
So sagen das die Doktormütter und -väter zwar nicht direkt, aber viele Promovierende übernehmen in vorauseilendem Gehorsam den Schreibstil, den sie aus den Skripten und Büchern ihrer Profs kennen. Diesen Stil halten sie für „wissenschaftlich“ – ist er aber nicht (mehr).
Was ist der Wissenschaftsstil? Die Sprache der Wissenschaft sollte präzise, prägnant und vor allem verständlich sein. Deswegen ist gerade der Stil der alten Skripte und Lehrbücher fehl am Platz – mit den vielen Schachtelsätzen, Nominalisierungen, passiven Formulierungen, lateinischen Fremdwörtern etc. ist dieser alte Stil oft alles andere als verständlich.
Leicht muss die Sprache sein, um den Leser angesichts der schweren Inhalte nicht zu überfordern.
Dr. Stefan Lang
Die medizinische Doktorarbeit – Schreiben mit System
Eine medizinische Doktorarbeit zu schreiben, ist wie eine Bergwanderung: Man braucht eine Karte, die den direkten Weg zum Ziel weist. Dieses Buch ist eine solche Karte. Es gliedert den Schreibprozess in Etappen, die die Promovierenden schrittweise absolvieren können.
Die medizinische Doktorarbeit – Schreiben mit System
kaufen bei
Paperback ISBN : 978-3-7482-9382-8
Hardcover ISBN : 978-3-7482-9383-5
E-Book ISBN : 978-3-7482-9384-2