Dr. Stefan Lang am 28. Mai 2019
Humane Sprache in medizinischen Texten – Mensch bleibt Mensch
Die Wissenschaftssprache ist eine nüchterne Sprache. Doch gerade in der Medizin ist es wichtig, dass die Sprache trotz aller Objektivität und Nüchternheit immer auch human bleibt.
Viel wurde geschrieben und diskutiert über die gendergerechte Sprache in medizinischen Texten. Doch die Wissenschaftssprache medizinischer Texte läuft nicht nur Gefahr, sexistisch zu sein, sondern auch inhuman – wenn nämlich Menschen auf ihre Erkrankung und Einschränkung reduziert werden.
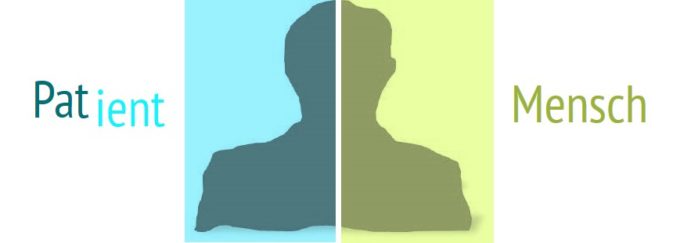
Humane Wissenschaftssprache
Nicht auf die Erkrankung reduzieren
Spricht ein Medizintext von einem „Asthmatiker“, wird diese Person damit vollständig auf ihre Erkrankung reduziert. Eine moderne und humane Wissenschaftssprache differenziert – zwischen Identität und Erkrankung:
eine Asthmatikerin- eine Patientin mit Asthma bronchiale
Gleiches gilt natürlich auch für das Wissenschaftsenglisch der Paper
diabetics- diabetes patients (oder: diabetic patients)
- patients with diabetes
- people with diabetes
Was heißt denn hier „krank“?
Selbst ‚Patient‘, das wohl häufigste Wort in medizinischen Texten, sollte mit Bedacht gewählt werden. Denn es impliziert, dass jemand krank ist und entsprechend eine medizinische Behandlung benötigt.
Aber würde sich jemandals ‚krank‘ bezeichnen, der eine Bewegungseinschränkung oder Lernbeeinträchtigung hat? Und erhalten Menschen mit einer Beeinträchtigung auch eine medizinische Behandlung? Die Wissenschaftssprache sollte hier genau bleiben und zwischen patients und individuals bzw. zwischen Patienten und Personen differenzieren.
Außerdem sollte der Grad der Beeinträchtigung in der Sprache eines medizinischen Textes berücksichtigt werden. Das erste Beispiel suggeriert eine mehr oder minder vollständige Bewegungsbeeinträchtigung, das zweite jedoch nicht:
- physically disabled patients, köperlich behinderte Patienten
- individuals with a physical disability, Personen mit einer körperlichen Einschränkung
Fazit
Beim wissenschaftlichen Schreiben in der Medizin geht es immer um Präzision, um die Präzision der Messergebnisse, der statistischen Auswertungen und der korrekten Fachbegriffe. Sorgen wir dafür, dass unsere Texte nicht nur präzise, sondern auch human sind.

